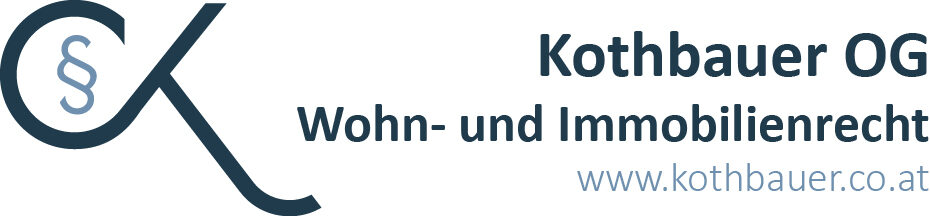Christine Kary, 06.03.2025
© 2025 MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH
Wien. Geschäftsraummiete oder Unternehmenspacht? Wie wichtig diese Unterscheidung werden kann, zeigte sich während der Pandemie: In Phasen mit eingeschränktem Geschäftsbetrieb hatten Mieter einen Anspruch auf Zinsminderung – die meisten Pächter jedoch nicht. Denn dieses Risiko muss ein (längerfristiger) Pächter laut Gesetz selbst tragen.
Und auch sonst bestehen gravierende Unterschiede zwischen Miete und Pacht. Vor allem ist auf Pachtverträge das Mietrechtsgesetz nicht anwendbar. Der gesetzliche Bestandsschutz greift daher bei Pachtverträgen nicht.
Aber wovon hängt es ab, welche Regeln gelten? In der Theorie klingt es simpel: Unternehmenspächter betreiben ein lebendes Unternehmen des Verpächters vorübergehend weiter. Geschäftsraummieter benützen dagegen die gemieteten Räumlichkeiten als Standort für ihre eigene Firma. In der Praxis kommt es dennoch oft zu Streitfällen. Eine aktuelle Entscheidung des OGH trifft dazu nun wichtige Klarstellungen ( 1 Ob 197/24p ).
Worum ging es in dem Fall? Eine GmbH hatte ein desolates Zinshaus so umgebaut, dass es sich für einen Hotelbetrieb eignet. Selbst hatte sie dort nie ein Hotel betrieben, das überließ sie via „Pachtvertrag“ einer anderen GmbH. Diese war für das Innendesign und die Möblierung verantwortlich, trug dafür die gesamten Kosten und kümmerte sich um die Konzeption, den Betrieb, die Vermarktung und das Anwerben von Personal. Sie übernahm keinen vorhandenen Kundenstock. Zudem war ein fixer, nicht umsatzabhängiger Bestandzins vereinbart.
Das Berufungsgericht qualifizierte den Vertrag – unabhängig von dessen Bezeichnung – als Geschäftsraummiete. Das Interesse der Gebäudeeigentümerin am Abschluss eines Pachtvertrags habe sich darauf beschränkt, „dass ein Pachtvertrag für sie rechtlich vorteilhafter sei“. Eine ernsthafte Absicht, selbst einen Hotelbetrieb zu führen, habe nicht bestanden. Letztlich habe sie bloß Räume und Flächen zur Verfügung gestellt, lautete das Fazit des Gerichts.
Bezeichnung war unrichtig
Das Gericht habe damit seinen Beurteilungsspielraum nicht überschritten, entschied der OGH. Dass die Parteien den Vertrag als Pachtvertrag bezeichneten, ist demnach für sich allein nicht maßgebend. Entscheidend war hier vielmehr, dass „die Vereinbarungen zur Betriebspflicht und zur Rückstellung eines lebenden Unternehmens auf keinem tatsächlichen wirtschaftlichen Interesse der Bestandgeberin beruhten“. Auch dass das vereinbarte Mitspracherecht in Personalangelegenheiten nach den gerichtlichen Feststellungen eine bloße Leerfloskel war, führt der OGH ausdrücklich an.
„Für die Qualifikation als Unternehmenspacht muss nicht nur bei Vertragsbeginn dem Bestandnehmer ein lebendes Unternehmen übergeben, sondern auch bei Vertragsende ein lebendes Unternehmen zurückgestellt werden“, sagt Rechtsanwalt Alfred Nemetschke zur „Presse“. In der Praxis werde in Verträgen immer wieder „auf Letzteres überhaupt vergessen, oder die entsprechenden Vertragsbestimmungen erweisen sich als Leerformeln ohne echtes Substrat“. Auch der „unausrottbaren“ Fehlannahme, es reiche aus, pro forma eine Betriebspflicht zu vereinbaren, habe das Höchstgericht eine Absage erteilt. „Die hier vom OGH aufgestellten Grundsätze gelten natürlich nicht nur für Hotels, sondern grundsätzlich genauso für Handels- und Gastronomiebetriebe“, betont Nemetschke.
Aber welchen Sinn hat die Differenzierung? Universitätslektor Christoph Kothbauer erklärt das in seinem Newsletter damit, dass stets derjenige schutzwürdig sei, der das Unternehmen aufgebaut hat: bei Geschäftsraummiete der Mieter, bei Unternehmenspacht der Verpächter. Geschäftsraummieter genießen daher grundsätzlich gesetzlichen Kündigungsschutz, Unternehmenspächter nicht.